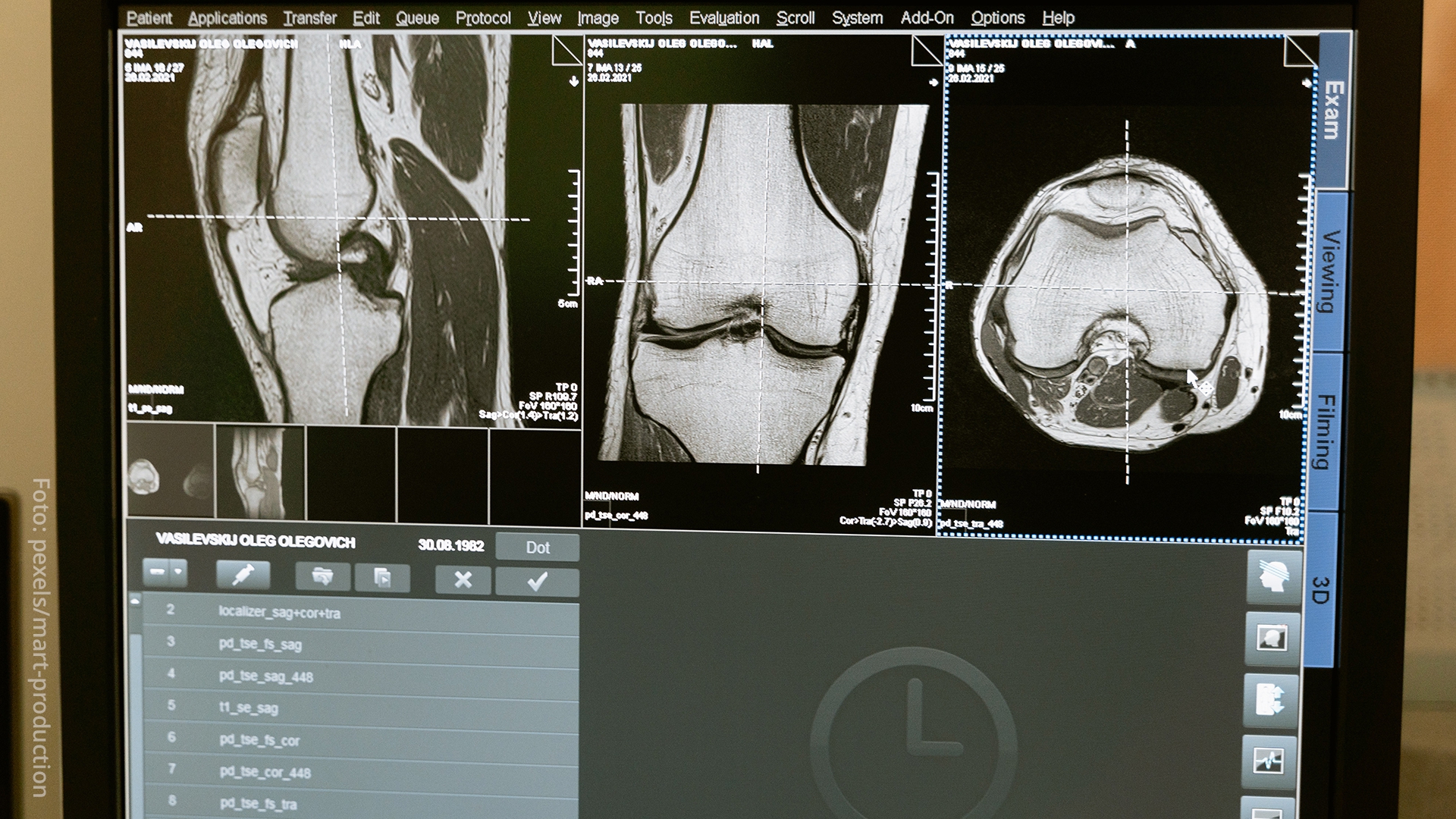Vitamin D spielt eine wichtige Rolle für die Körperfunktionen und kann bei vielen Infektionen und Krankheiten unterstützen. Dafür sind gute Konzentrationen im Körper nötig. Die Versorgung mit Vitamin D kann jedoch aufgrund vieler Faktoren unterschiedlich sein und sollte individuell angepasst sein.
Vitamin D ist ein essentielles, fettlösliches Vitamin mit besonders vielfältigen Funktionen. Seine klassische Aufgabe ist es, das Muskel-Skelett-System zu stärken. Dazu gehören z. B. die Wirkungen auf den Stoffwechsel von Mineralien, die Regulierung des Kalzium- und Phosphat-Haushalts und die Funktionen des Bewegungsapparates. Vitamin D hat jedoch weitaus mehr Funktionen, besonders im Immunsystem, dazu im Herz-Kreislauf, Lungen-, Magen-Darm- und Nieren-System sowie in den neurologischen Funktionen. In den letzten zwei Jahrzehnten erweiterten sich die Kenntnisse über Vitamin D und seine Funktionen im Immunsystem samt den Wirkungen auf Entzündungen und den oxidativen Stress. Mehr bekannt ist auch über die Funktionen der verschiedenen Formen von Vitamin D (D2, D3) sowie die Prozesse der Umwandlung bis zur Verwertung und Speicherung im Körper.
Vitamin D unterscheidet sich von anderen Vitaminen dadurch, dass es hauptsächlich über die Einwirkung des Sonnenlichts auf die Haut gebildet wird (80 bis 90 %). Der Anteil, der aus der Nahrung aufgenommen wird, ist vergleichsweise gering (ca. 10 bis 20 %). Vitamin D ist nur in wenigen Lebensmitteln enthalten, es kommt vor allem in fettreichen Fischen (z. B. Lachs, Hering, Makrele) und Eiern vor. Um die Versorgung über die Nahrung zu verbessern, ist Vitamin D einigen Lebensmitteln in geringen Mengen zugesetzt.
Die Bildung von Vitamin D über das Sonnenlicht und seine Einwirkung auf die Haut ist in den nördlichen Regionen im Herbst und Winter deutlich geringer, da die Sonne weniger und nicht intensiv genug scheint. Daher komm es in dieser Zeit häufiger zu Defiziten an Vitamin D, wenn die körpereigenen Speicher nicht ausreichend gefüllt sind. Auch die Vorkommen von Atemwegskrankheiten, Erkältungen, Grippe und COVID-19 steigen im Winter stärker an. Dazu kann ein Vitamin D-Mangel beitragen, er erhöht allgemein das Risiko für Entzündungen, Krankheiten und Infektionen. Er kommt bei Menschen im höheren Alter, bei Komorbiditäten und chronischen Krankheiten, z. B. bei starkem Übergewicht, Bluthochdruck, Diabetes und Krebs, häufiger vor. Defizite oder gar der Mangel an Vitamin D können sich nachteilig auf alle Körpersysteme auswirken.
Sie können jedoch mit einem sicheren, täglichen Aufenthalt in der Sonne und/oder mit einer angemessenen Ergänzungs-Dosis beseitigt werden. Dabei gehen eine Reihe von Fachleuten heute davon aus, dass die Aufrechterhaltung der Vitamin-D-Konzentration im Serum (25(OH)D) bei Werten von 40 ng/ml (100 nmol/L) bzw. am besten noch etwas darüber liegen sollten. Das sind höhere Werte als bisher in den üblichen Empfehlungen angesetzt. Eine gute Versorgung mit Vitamin D stärkt nicht nur die Knochengesundheit, sie unterstützt auch ein gesundes Immunsystem und kann dazu beitragen, das Risiko für viele chronische Krankheiten und Infektionen zu verringern.
Bekannt ist, dass vor allem ältere Menschen, Nachtarbeiter, Heimbewohner sowie Patienten mit chronischen Krankheiten und Komorbiditäten die höchsten Vorkommen von Mängeln an Vitamin D haben. Sie können von einer gezielten Ergänzung von Vitamin D und gegebenenfalls auch von anderen wichtigen Mikronährstoffen erheblich profitieren. Bekannt ist weiter, dass bei Ergänzungen von Vitamin D die Dosen individuell angepasst werden sollten. So können z. B. die Funktionen im Muskel-Skelett-System meist mit geringeren Dosen (800 bis 2.000 I.E.), aufrechterhalten werden. Höhere Dosen werden meist benötigt, um den Schutz vor Infektionen zu stärken. Auch das Gewicht spielt bei der Dosierung eine Rolle, wer z. B. übergewichtig ist oder eine gestörte Fettabsorption hat, braucht meist höhere Aufnahmen. Generell sollten höhere Dosierungen nicht auf eigene Faust eingenommen werden, sondern nach therapeutischer Empfehlung erfolgen.
Es dauert außerdem oft einige Zeit der Ergänzung von Vitamin D, um gute Serum-Konzentrationen zu erreichen. Die Aufnahmen sollten möglichst kontinuierlich erfolgen, da unregelmäßige Verabreichungen zu unphysiologischen Schwankungen der Serum- und Gewebespiegel von Vitamin-D-Metaboliten führen können. Einige Meta-Analysen zur Ergänzung von Vitamin D berichteten z. B über eine signifikant geringere Häufigkeit und Schwere von Atemwegs-Infektionen. Dabei wurden bei täglichen Vitamin-D-Gaben bessere Ergebnisse erzielt als bei einer unregelmäßigen Verabreichung.
Der Forscher zieht das Fazit: Vitamin D hat zahlreiche positive Wirkungen auf alle Körpersysteme. Eine ausreichende Versorgung ist der Schlüssel zum Schutz für verschiedene Bevölkerungsgruppen. Serumkonzentration von 25(OH)D in der Bevölkerung von über 40 ng/ml sorgen für ein robustes Immunsystem. Damit könnten die Ausbreitung von Infektionen eingedämmt und viele Krankheiten verringert werden. Ein ausreichender Vitamin-D-Spiegel kann z. B. dazu beitragen, akute Virusinfektionen zu senken. Abgesehen von der Vorbeugung von Infektionen und Krankheiten kann Vitamin D zusätzlich zu anderen Therapien und Arzneimitteln eingesetzt werden.
Unser Tipp: Vitamin D ist ein sehr wichtiger Mikronährstoff (nicht nur) im Immunsystem. Die Gabe auch anderer Mikronährstoffe, z. B. von Zink, Selen und Magnesium sowie den Vitaminen A, B2, C und Resveratrol in Kombination mit den Omega-3-Fettsäuren kann die Aufrechterhaltung eines stabilen Immunsystems weiter unterstützen.